Copyright: Gerd Rasquin
- Dezember 2007,
letztmalig aktualisiert am 1. Oktober 2021.
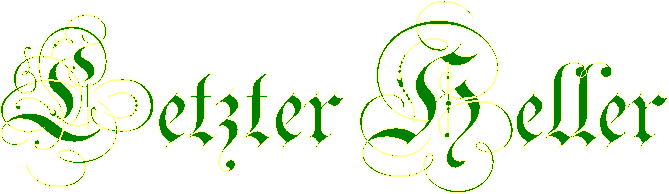
Grenze, Tierpark,
Endstation und Volksvergnügen!
Das Leben der Horner Bevölkerung vom
Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert war alles andere als romantisch:
Mühsame Alltagsarbeit, fehlende medizinische Versorgung, hohe
Kindersterblichkeit und tristes Leben in dunkler Jahreszeit, denn
Kerzenbeleuchtung konnte sich kaum jemand leisten. Auch Brennholz war teuer und
durfte nur nach Genehmigung des Waldvogts anlässlich besonderer Feste
geschlagen und gesammelt werden. Alltägliches Brennmaterial für die Küche
musste der Hof hergeben. Da wird verständlich, warum sich Kneipen, Wirtshäuser
und Lokale schon immer großer Beliebtheit erfreuten. In gemütlicher Enge war es
hier wärmer als zuhause, konnten Dorfbelange beredet, neueste Informationen
ausgetauscht werden. Am belebten Heerweg (Horner Landstraße) traf man auch auf
Durchreisende, Händler und Kutscher, die sich vor Anbruch der Nacht noch
schnell einquartierten. Wer des Nachts wieder heim musste, hatte in mondhellen
Nächten kein Problem. War es aber dunkel, mussten Handlaternen oder Fackeln die
holperigen Sandwege erhellen, denn erst ab 1864 säumten Gaslaternen die
Straßen.
Eine
echte Grenze besaß Horn seit 1460, als Holstein dänisches Herzogtum wurde. Man
darf zu Recht vermuten, dass am Weg nach Billwärder schon bald darauf ein
Gasthaus eröffnete, denn die Landstraße war der einzige Weg, um von Hamburg aus
östliche und südliche Gebiete Europas erreichen zu können. Jahrhundertelang
überquerten Pferdefuhrwerke die Elbe kurz vor Lauenburg, wo sie auf die
"Alte Salzstraße" trafen. Am Weg nach Billwärder endete einst der
Hammerbrook, ein sich von Hamburg aus erstreckendes Marschgebiet.
Einige
der Grundeigentümer des östlichsten Flurstücks konnten erforscht werden. Um
1346 war es die Familie Hetfelt, doch die folgenden Jahrhunderte liegen im
Dunkeln. Ende des 17. Jahrhunderts erwarb es der angesehene Hamburger Kaufmann
Johann Clamer. Am Nordrand seines bis zur Bille reichenden Grundstücks ließ er
ein einstöckiges Landhaus mit großzügigen Räumlichkeiten und rechts der
Arealeinfahrt ein ebenerdiges errichten, beide mit Spitzdach. Am 11. Juli 1701
heiratete er Elisabeth Vegesack, doch das Haus wurde weiterhin nur als
Sommersitz genutzt, entbehrliche Räumlichkeiten an einen Gastwirt vermietet.
Der nannte sein Lokal "Letzter Heller", in Anspielung darauf, dass
manche Menschen hier oft ihr letztes Geld verprassten*. Mit dem seit 1687
schräg gegenüberliegenden Grenz- und Wachtposten Hamburgs hatte der Begriff
"Letzter Heller" nichts zu tun. Da sich das Lokal aber schon im
frühen 18. Jahrhundert zum beliebten Ausflugslokal entwickelte, nannte man die
Wache ortsbeschreibend einfach nur "Wache
beym Letzten Heller". Wegegeld ließ Hamburg hier übrigens erst seit
dem 1. Januar 1830 erheben, jedoch auch nur einreisende Fuhrleute.
*Der "Heller" geht zurück auf den Ort Schwäbisch
Hall, wo die Münze im 13. Jahrhundert als "Haller Pfennig" geprägt
wurde. Bis zur Einführung der Mark war es die kleinste Münzeinheit und
entsprach einem halben Pfennig.
Doch
zurück zum Ehepaar Clamer. Ihren ersten Sohn nannten
sie Wilhelm (13.9.1706–21.9.1774), später einmal ein "höchstberühmter Kauf- und Handelsherr der kaiserlichen freien
Reichsstadt Hamburg". Am 10. März 1750 wählte man ihn sogar zum
Ratsherrn (genau an dem Tag, als die St. Michaeliskirche abbrannte) und später
auch zum Landherrn von Hamm und Horn. Am 14. Mai 1734 heiratete er Anna Maria
Boons, doch die starb am 18. Juli 1735, drei Tage nach der Geburt ihrer
Tochter. Wilhelm Clamer heiratete dann noch einmal und zwar am 30. April 1737
Cäcilia Elisabeth Schlüter, deren Tochter jedoch schon bei der Geburt verstarb.
Am 26. August 1738 wurde Guilliam (26.8.1738–7.6.1795) geboren, später
in der Firma seines Vaters beschäftigt, die er im Jahre 1760 ganz übernahm.
Nachdem er verstorben war, verkauften die Erben das Grundstück an den
Oberalten Johann Anton Schmidt (21.4.1751–5.1.1828), den eine Hammerbrook-Karte
des Deichinspektors H.W. Heydemann (†1820) aus dem Jahre 1806 ausweist. Die
Gebäude auf der Flurkarte von 1751 sind dort nicht mehr eingezeichnet, dafür
aber ein einstöckiges Haus mit drei Erkern im Spitzdach, das uns von einer Lithographie
zu Zeiten des "Thiergartens" (1841–1845) bekannt ist. Es lag etwa vierzig Meter westlich des Wegs
nach Billwärder. Anton Schmidt war seit dem 29. April 1777 mit Maria Dorothea
Rücker verheiratet, Kind einer einflussreichen Hamburger Kaufmannsfamilie. Ihr Sohn verkaufte die Immobilie
1836 an Carl Heinrich Ferdinand Rochow und Wilhelm Kirchheim aus Wandsbek. Rochow et Kirchheim (laut Adressbuch)
arbeiteten in der "Expedition der Journalière von Ham und Horn" am
Platz neben der heutigen Hauptkirche Sankt Petri. Diese Journalière, ein von
zwei Pferden gezogener Wagen, verkehrte seit dem 27. Juli 1835 zweimal täglich
zwischen Hamburg und dem Letzten Heller. Mit ihr konnten jetzt auch einfache
Bürger dem penetranten Gestank des engbebauten Hamburgs entfliehen, denn
Abwässer und Fäkalien wurden ja noch in Gossen und Fleete entsorgt. Man kann
sich leicht vorstellen, wie überfüllt es nun an Wochenenden im Gasthaus von
Rochow und Kirchheim gewesen sein mag.
Als
Rochow 1840 schwer erkrankte (er starb 1841, die Witwe zog nach Altona)
entschlossen sich die Geschäftsleute, den Gasthof in Horn aufzugeben. Mit
Schardel Heinrich Berg fanden sie einen aus Russland stammenden
Wandermenageristen, der das Gasthof-Areal erwarb, um hier nach den Vorbildern
der Menagerien zu Wien und Paris sowie der Pfauen-Insel bei Potsdam für seine
Tiere eine Heimat zu schaffen, angepasst an die klimatischen Bedingungen
Hamburgs und den üblichen Anforderungen der Stadt an öffentliche
Vergnügungsorte. Auch die seit dem 28. Juni 1840 zweite
Pferde-Omnibusverbindung nach Horn mag ihn in seiner Entscheidung bestärkt
haben. An die Ostwand des Lokals ließ er einen etwa 17x7 Meter großen Saal mit
Spitzdach anbauen und das 287x108 Meter große Gesamtareal umfangreich neu
gestalten, sodass er am 30. Mai 1841 (Pfingstsonntag) einen "Zoologischen oder Thiergarten" eröffnen konnte, übrigens den ersten auf
dem Gebiet des heutigen Deutschlands! Für die Besucher hatte er bei J.J.S.
Wörmer (am Pferdemarkt 7) einen 16-seitigen "Führer
durch den Zoologischen oder Thiergarten" drucken lassen. Bei einem
Eintrittspreis von acht Schillingen begann auch alles recht hoffnungsvoll, und
Gastwirt Berg erwartete mit Spannung den nächsten Frühling, denn viele neue
Tierarten waren hinzugekommen. Vom 5. bis 8. Mai 1842 geschah dann aber das
Unfassbare: Ein Viertel des Hamburger Stadtgebiets wurde durch ein mächtiges
Feuer vernichtet. Folglich gingen die erhofften Besucherzahlen zurück und
Schardel Heinrich Berg sah sich für 1843 gezwungen, den Eintrittspreis zu
halbieren. Im Hamburger Adressbuch stand damals Folgendes: „Die Bemühungen
des Eigentümers sind bis jetzt eben nicht vom besten Erfolge gekrönt worden,
weil die Witterung für den Aufenthalt im Freien keine günstige und einem
häufigen Besuche hinderlich war. Dennoch muss jeder Unparteiische gestehen,
dass Herr Berg schon sehr viel geleistet hat und fortwährend das löbliche
Bestreben zeigt, sein Institut mit neuen Exemplaren verschiedenartiger
Tiergattungen zu bereichern. Ein detailliertes Verzeichnis sämtlicher bemerkenswerter
Vier- und Zweifüßler zu geben, gestattet der Raum nicht. Wir beschränken uns
daher auf folgende Fingerzeige: Das türkische Gebäude enthält Schlangen und
Crocodille sowie eine reichhaltige Vogelsammlung, bestehend aus Cardinalvögeln,
blauen Dohlen, javanischen Sperlingen, Liebesvögeln, vielen Papageien etc. Die
Fasanerie bietet in zehn Gehegen eine herrliche Collection von Gold- und
Silber-Fasanen sowie Perl- und spanischen Hühnern. Ein zweites geräumiges
Gebäude ist für den Aufenthalt verschiedener Affen bestimmt, und in kleinen
Käfigen sieht man Waschbär, Murmeltier, Ichneumon, Zibetkatze u.a. mehr. Das
große gotische Bauwerk umschließt die eigentliche Menagerie, die aber zurzeit
noch wenig reichhaltig ist, und sich größtenteils auf Hyäne, Panther, Jaguar,
Wolf und Bär beschränkt. Mehrere Gehege, Zwinger etc., welche malerisch im
Garten verteilt sind, enthalten Lamas, diverse Exemplare in- und ausländischer
Ziegen, australische Kasuare und Kängurus, astrachanische Schafe, das
astrachanische Kamel etc. Auf dem in der Mitte des Gartens liegenden Teich ist
eine Insel; beide werden belebt durch eine Menge verschiedener Schwimmvögel,
größtenteils ausländischen Ursprungs. Der Pelikan spielt hier die Hauptrolle.
Speciellere Auskunft gibt der Catalog "Führer durch den Zoologischen oder
Thiergarten", welcher mit Sachkenntnis abgefasst ist und bereits seine
dritte Auflage erreicht hat. Seine Vorderseite ziert eine fauchende Raubkatze.
Pferde-Omnibusse und Journalièren verkehren während der Sommertage stündlich,
sowohl von Hamburg als auch vom Thiergarten. Acht Schillinge (eine halbe Mark
Courant) kostet der Eintritt.“
Nach der Sommersaison 1845 musste Berg
seinen Thiergarten schließen, denn nach dem Großen Hamburger Brand im Mai 1842
waren die Besucherzahlen zurückgegangen. Zwar führte er die Gastwirtschaft in
Nr. 40 noch bis 1847, doch wurde die gesamte Immobilie schon am 5. März vom
Makler Harry Lipschütz zum Verkauf angeboten. Bis 1854 ist Berg dann nur noch
als Bewohner von 41 im AB vermerkt. Dann soll er in seine russische Heimat
zurückgekehrt sein.
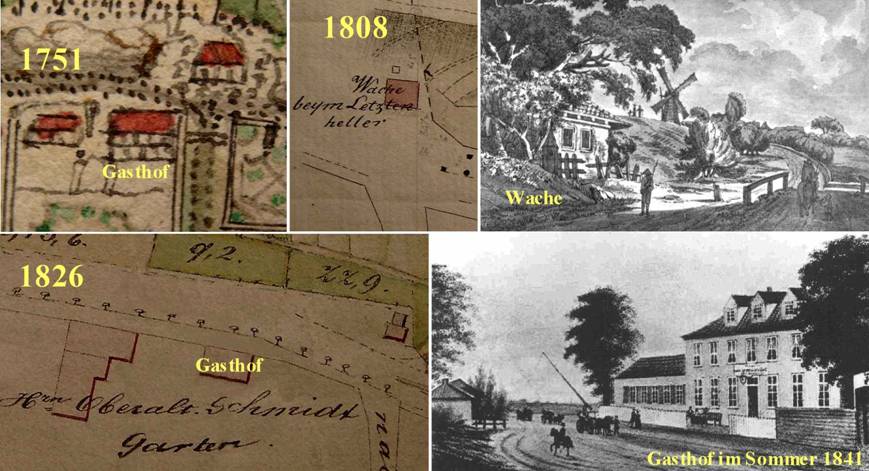
Nachfolgender Wirt war von 1849–†1855 Gustav Carl Börner über
dessen Lokal ein Zeitung 1852 schrieb: „Flügel-Bälle und ein großer schöner Garten,
ehemals Thiergarten, machen dieses Local zu einem angenehmen Aufenthalte.“
Nach dem letzten Wirt H.F.C. Behrens erwarb Johann Heinrich
Kleindiecks den Gasthof, ließ ihn umbauen und am 18. Mai 1859 (Mittwoch) als „auf's
eleganteste decorirte und eingerichtete Etablissement“ eröffnen, das er
Conversations-Haus nannte. Dazu gehörte auch noch sein "Hotel Garni".
In den "Hamburger Nachrichten" warb er nicht nur für ein
allsonntägliches "Thable d'hôte" (Mittagsmenü) um 17 Uhr,
sondern auch für "Déjeuners, Diners und Soupers" zu jeder
Tageszeit. Außerdem sollten mittwochs und sonntags Konzerte renommierter
Kapellen stattfinden. Für sein Hotel bot Kleindiecks die Vermietung mehrerer
möblierter Zimmer an. Aus bislang unbekannten Gründen gab er Etablissement und
Hotel im Jahre 1861 auf und arbeitete von 1863–†1869 in Hamburg als Haus- und
Versicherungsmakler.
Der Name "Letzter Heller" tauchte erst wieder 1862 auf,
als F.G. Meyn Wirt wurde (vorher wohnhaft an der Marienstraße 10). Von 1865–1868 stand H.G.R. Schrader als
Gastwirt in den Adressbüchern, doch die 1868 herausgegebene Karte der Vogtei
Horn weist kein Gebäude bzw. die Hausnummer 40 aus, und auch Schrader findet
man fortan nicht mehr. Gleich danach
wird aber ein neues Haus errichtet worden sein, denn im Adressbuch von 1869
steht wieder die 40, allerdings nicht
mit einem Wirt, sondern dem Bleicher J.F. Holdmann als Bewohner (vorher in 7). Im Herbst war auch noch August
Friedrich van Scherpenberg von der Englischen Planke 18 hierhergezogen, um die Tradition der
Gastwirtschaft "Letzter Heller" fortzusetzen. Leider ist uns kein
Bild des Hauses überliefert. Im Jahre 1876, als "Perez Bloch &
David Martienssen" Grundeigentümer geworden waren, hatte Carl Cornehls das Lokal übernommen, vorher Betreiber eines
Restaurants nebst Austernkeller am Jungfernstieg 10. Im Jahre 1879 war dann Friedrich Johann Heidtmann neuer Wirt
geworden, der noch eine Herings- und Austernhandlung am Dornbusch 6 besaß.
Nachdem die Brüder Emil Carl & Ludwig Stockmeyer die Immobilie Im
Frühjahr 1881 erworben hatten, übernahm Heidtmann ein Kellerlokal am
Jungfernstieg 11.
Emil Carl
Stockmeyer* hatte seit 1877 eine Bäckerei am Steindamm 76 in St. Georg besessen, doch über seinen
Bruder Ludwig ist nichts bekannt, die AB vermerkten ihn nie. Noch im Frühjahr
ließ man ein zweistöckiges Hotel errichten und nannte das Gesamtobjekt nebst
Festhalle und großem Außenbereich "Horner Park", ein
Vergnügungs-Etablissement, das schon zur Sommersaison 1881 eröffnet werden
konnte und seinerzeit als das größte Hamburgs galt. Den traditionsreichen Namen
"Letzter Heller" hatte im selben Jahr der Gastwirt Heinrich Siemers
übernommen. Sein Lokal lag einhundert Meter weiter nordöstlich, an der Horner
Landstraße 355.
*später, bis zu seinem Tod im Jahre 1915,
arbeitete er als Makler, nach mehrmaligen Wohnortswechseln zuletzt am Lehmweg 7
zusammen mit seinem Sohn, derzeit von Beruf Oberkellner.
Im "Horner Park" fanden Volks-, Tanz- und Kinderfeste
statt, sowie sonntags und mittwochs Vorstellungen im Theatersaal. Für sonntags,
mittwochs und freitags plante man Konzerte und allsonntäglich einen
"Großen Ball" in der Festhalle. Stockmeyer warben mit 26 Fremden- und
mehreren Clubzimmern, Billard, zwei guten Kegelbahnen, Stallungen für dreißig
Pferde und zwölf Boxen für Rennpferde. Zuletzt standen die Gebrüder Stockmeyer
als Besitzer vom "Hotel zum Horner Park" im Hamburger Adressbuch von
1882. Noch im selben Jahr hatte Wilhelm Sträter die Immobilie übernommen, vorher
Besitzer eines Delikatessen- und Frühstückslokals an der Fuhlentwiete 92. Warum
die Brüder Stockmeyer so schnell aufgaben ist nicht überliefert. Möglicherweise
war es doch recht schwierig, einen derart großen Betrieb rentabel zu führen,
zumal alle Veranstaltungen im Außenbereich wetterabhängig waren. Weitere rasche
Gastwirtwechsel bestärken diese Vermutung, denn auch Wilhelm Sträter gab
bereits 1884 auf, um fortan ein Lokal am Valentinskamp 31 in Hamburg zu
bewirtschaften. Dabei schrieben die "Hamburger Nachrichten" noch am
17. Juli 1882:
„Der Horner Park, vormals Letzter Heller, welcher bekanntlich
vor einiger Zeit in den Besitz des Herrn Wilhelm Sträter übergegangen ist, übt
jetzt noch in erhöhtem Maße seine Anziehungskraft auf das vergnügungslustige
Publikum aus. In dem prächtigen Saal des Etablissements wurde trotz 26 Grad
Réaumur (32,5° Celsius) fleißig das Tanzbein geschwungen. Im Garten concertirte
eine vortreffliche Militair-Capelle. Die Restauration des Herrn Sträter wurde
stark in Anspruch genommen; dieselbe darf als durchaus zufriedenstellend
bezeichnet werden. Am 14. und 16. Juli trat der bekannte Schnell- und
Dauerläufer Adolf Dibbels aus Wien auf.“
Auf Wilhelm Sträter folgte
1884 Bernhard Wahlen und schon 1885 Hans Heinrich Friedrich Singelmann. Am 3.
März 1893 war Johann Wilhelm Kück (†1915) neuer Grundeigentümer geworden,
wohnte aber an der Ferdinandstraße 24. Gastwirt war der Barbier T.H. Ernst. Von
1895–1897 war Adolf Hübsch hier
Gastwirt, dann folgte Albert Krohn. Im AB finden wir hinter seinem Namen
"Tanzsalon, Kegelbahn und Gastwirtschaft". 1902 wurde der
Mineralwasserfabrikant Georg Schaardt neuer Gastwirt und 1910 Carl Hugo Alex,
der sein "Vergnügungslokal" zusammen mit Ehefrau Anna Georgine
Juliane bewirtschaftete. 1920 verkaufte er sein Vergnügungslokal an Georg
Demuth, zog zwischenzeitlich an die Horner Landstraße 301 und schon 1921 in
sein neuerworbenes Haus nach Neuschönningstedt. Eine seiner sechs Töchter, die
am 9.2.1896 geborene Martha Caroline, lebte dann dort seit 1958. Georg Demuth nannte
das ehemalige Vergnügungslokal fortan "Hamm-Horner
Gesellschaftshaus", das er in Zeitungsanzeigen um 1926 als "Hamburgs
schönstes Ball- und Gartenlokal" pries sowie auch als "Treffpunkt
aller Freunde des Fußballsports". Für die von Wacker 04 war es nämlich
Vereinslokal, in dem man gern das Lied von der "Horner Sonne" sang.
Bereits 1922 hatte Demuth die Immobilie an den Oberpostsekretär P.H.O. Fründ
aus der Richardstraße 11 verkauft, der sie wiederum 1926 an den Staat
veräußerte. Im Jahre 1928 mietete Rudolf Neubeyser das historische Gelände und
gab ihm nochmals einen neuen Namen: "Horner Volkspark". Am 24.
August 1929 war dort wieder ein "Mordsbetrieb", wie einer Postkarte
zu entnehmen, die ein Vater an seinen Sohn Paul Lewald ins Kinderheim Wyk auf
Föhr schickte. Unterschrieben hatten zudem Lehrer Paul Möhring und Schulleiter
Peter Hähne, die ebenfalls am Volksfest teilnahmen, denn es gab auch
"Schüler-Singen" sowie "Schüler-Turnen". Seinem "Horner
Volkspark" gab Neubeyser 1935 wieder den vorherigen Namen "Hamm-Horner
Gesellschaftshaus", dessen letzte Wirtschafterin von 1941 bis zur
Ausbombung im Juli 1943 Hildegard Jalant war. Neubeyser ist noch im Telefonbuch
von 1970 als Buchsachvertändiger und Steuerbevollmächtigter vermerkt, als er an
der Palmerstraße 20 wohnte. Von Hildegard Jalant ist aber nichts mehr bekannt.
Auf dem Areal des
zerstörten Gesellschaftshauses standen seit 1949 kleine Behelfshäuser mit den
Hausnummern 326–330: In 326 befand
sich seit 1949–1953 eine Außenstelle
der KPD für den Stadtteil Horn und seit 1952 die Autoreparatur und
Henschel-Vertragswerkstatt von Ernst Saubert, der 1953 mit seinem Geschäft an
den Horner Brückenweg 10 zog. In Nr. 328 besaß Georg Krüger seit 1949 eine
Hundehandlung mit der er 1953 an die Weddestraße 37 zog, und in Nr. 330
eröffnete Hertha Albrecht 1952 eine Seifenhandlung. Sie zog 1954 in den ersten
Stock des Neubaus Nr. 328.
Nachdem Friedrich
Maschmann aus der Wagnerstraße 9 zwei Drittel des Areals vom Staat erworben
hatte, auf dem einst das "Gesellschaftshaus Neubeyser" stand, ließ er
dreistöckige Wohnhäuser mit zusätzlichen Wohnungen im Dachgeschoss und je zwei
Ladengeschäften errichten, die 1954 bezogen werden konnten. In 328 eröffnete
Julius Busch eine Filiale seiner Bäckerei und in 330 Heinrich Boye ein
Lebensmittelgeschäft sowie Magdalene Römhild eine Textilfiliale. Im Jahre 1956
eröffnete Gisela Bohnsack im Haus eine Gaststätte, die "Horner Eck"
hieß und noch einige Wirtswechsel erleben sollte.
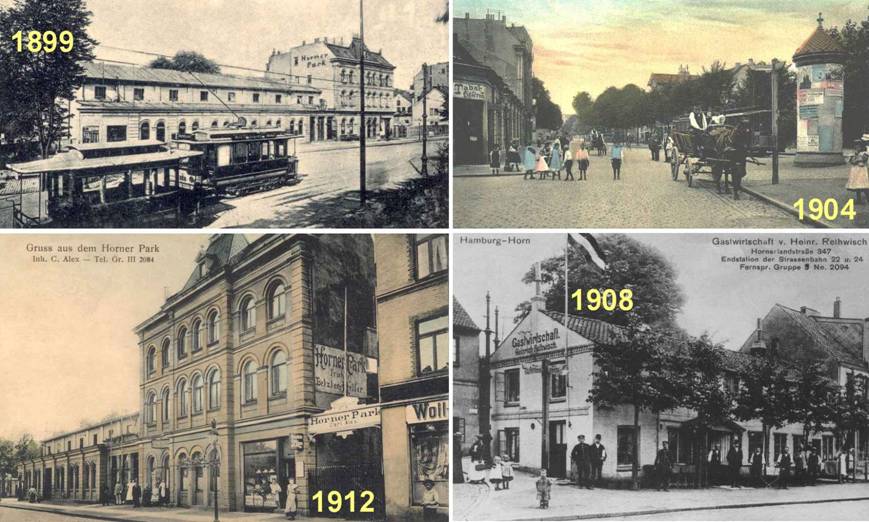
Zwei Fotos zeigen die Endstation der Straßenbahnlinie
24 (später auch der 22 und 11) am "Weg nach der Blauen Brücke".
Den "Horner Park" betrat man
rechts neben dem Wohnhaus, das bis 1892 Hotel und Pension war. Im flachen Anbau
befand
sich der Festsaal. Die Gastwirtschaft
von Heinrich Rethwisch stand direkt an der Straßenbahn-Endstation gegenüber dem
Weg nach Billwärder, einst auch
"Weg nach der Blauen Brücke" genannt.
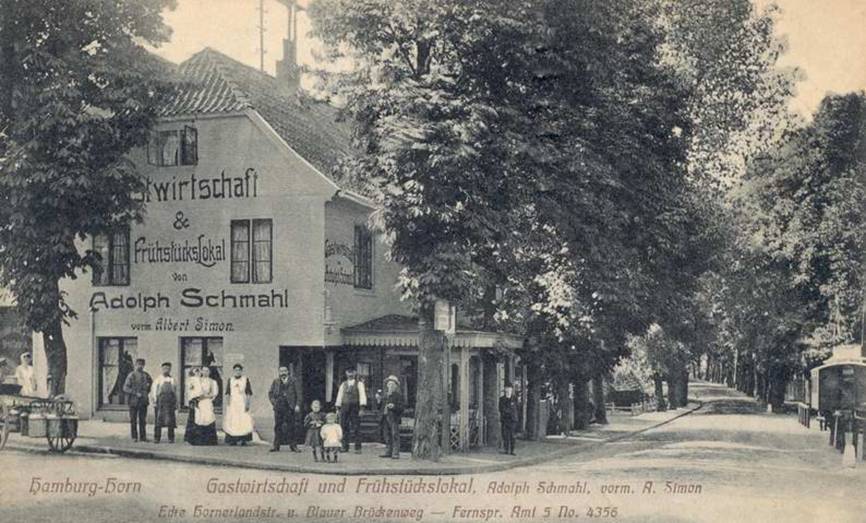
Auf einer Karte vom 11. Oktober 1770 ist hier, an der Ostecke zum
Weg nach Billwärder, "Clamer's Garten" eingezeichnet, jedoch noch
ohne Gebäude. Gleich dahinter verlief die Grenze zur holsteinischen Dorfschaft
Schiffbeck. Das Haus auf einem 525 qm großen Grundstück hatte Johann Heinrich Wilhelm
Meyer 1856 errichten lassen. Er wollte hier aber nicht wohnen, sondern nur
vermieten. Im Jahre 1881 hatte Meyer sich entschlossen, die Eckwohnung im
Erdgeschoss zu einer Gastwirtschaft umzubauen, in der er bis zu seinem Tod 1891
auch selbst Wirt war, anschließend die Witwe. Eine Hausnummer war erst am 9. Mai 1888 erteilt, nachdem in den
Hamburger Adressbüchern immer nur "Beim letzten Heller" gestanden
hatte. Im Winter 1893/94 ließ sie an der Westseite des Hauses eine Veranda
anbauen, die das Gastzimmer vergrößern sollte. Am 30. September 1895 erwarb A.
Ludwig Post die Immobilie. Er ließ das Fachwerk zur Hornerlandstraße durch eine
massive Mauer ersetzen und an der Südseite des Hauses ein "Closet und
Pissoir" anbauen. In der ersten Etage vorn wohnte Schramm und hinten der
neue Gastwirt Hermann Köhler. Im Jahre 1897 erwarb Johann Jacob Friedrich Albert
Simon die Immobilie und war dann auch Gastwirt, bis Adolph Schmahl das Lokal
1909 übernahm. Nach einigen Umbauarbeiten im Frühjahr 1914 stand nun
"Gastwirtschaft und FrühstücksLokal" an der weißgemalten Hausfront.
1921 wurde Eugen Steuber neuer Gastwirt, doch schon im Jahr darauf Carl Krempe.
In den Jahren 1923–1925 stand
"Großdestillation Heinrich Toosbuy" in den Adressbüchern,
anschließend von Fritz Bohr übernommen. Schon im Herbst 1926 war hier wieder
eine ganz normale Gastwirtschaft, der Johannes Peter Hinrich Hagenah mit
"Horner Grenzhaus"
erstmals einen Namen gab. Auf die weiße Frontwand hatte er Fachwerk malen
lassen, damit das siebzig Jahre alte Haus etwa wieder so aussehen sollte wie
einst zur Dorfzeit. Am 19. Juni 1929 verkaufte Hagenah die Immobilie für 45.000
RM an die Hamburger Finanzdeputation, wohnte hier aber bis noch zur Zerstörung
1943 als Mieter und Bewirtschafter des Lokals. Gleich nach dem Krieg übernahm
er eine Gastwirtschaft an der Lutherstraße 2 in Harburg. Das Grundstück wurde
erst wieder 1989 mit dreistöckigen Mehrfamilienhäusern bebaut.