Copyright: Gerd Rasquin - Erstellt
1999, letztmalig bearbeitet im Februar
2023.
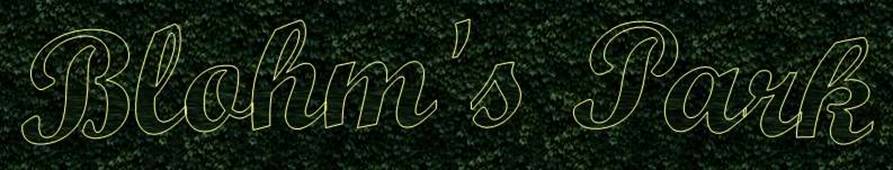

Die erste Horner Flurkarte von 1751 dokumentiert vier Grundstücke
auf einem Areal, das wir heute als Blohm’s Park kennen. Das westliche war
seinerzeit unbebaut und diente als Vorgarten mit Teich für das südlich
gegenüberliegende Anwesen der Familie Konau, am Südrand der Landstraße. Ein
etwa 25 Meter breites Grundstück mit Sommersitz grenzte rechts an und daran ein
weiteres mit zwei Häusern. Der östliche Teil, einschließlich heutiger
Hertogestraße, gehörte Philip Christoph de Hertoghe, dessen Vorfahren hier
schon seit 1630 ein Landhaus besaßen. Erstmals wurde dieses Grundstück anno
1600 im Grundbuch erwähnt: "4 Morgen
Marschlandes bei Hinrich Schröder mit einer Kate, den Geestkamp, zwei Blöcke,
dem Gehege und allerlei pertin"
(Zubehör). Erster uns bekannter Bewohner war der Kaufmann Albert van
Eitzen, am 10. Mai 1614 ins Grundbuch eingetragen. Am 25. Juni 1609 hatte er
Gesa von Schöningen geheiratet (†1650), mit der er acht Kinder bekam. Seit 1610
war van Eitzen Ratsherr (Senator) und von 1623–†1653 sogar Hamburger
Bürgermeister. Während er alltags in seinem Stadthaus arbeitete, lebte seine
Familie in den wärmeren Monaten in ihrem Horner Landhaus.
 Albert van Eitzen (6.9.1578–4.5.1653)
Albert van Eitzen (6.9.1578–4.5.1653)
Am 14. Januar 1630 verkaufte Albert von Eitzen sein Grundstück an
Hans de Hertoghe. Dessen
Familie waren Lutheraner, die in den seinerzeit spanischen Niederlanden schon
lange brutal verfolgt wurden. Die ersten Flüchtlinge erreichten das liberale
Hamburg schon 1567. Noch bevor spanische Soldaten Antwerpen am 17. August 1885
eroberten, kam es zu einer zweiten Flüchtlingswelle, mit der auch die Hamburger
Geschichte der Familie de Hertoghe begann. Seinerzeit erreichte auch ein Cornelis de Hertoghe (1545–7.1.1612) mit seiner Familie die
Hansestadt. Cornelis war Kaufmann geworden, hatte noch in
seiner niederländischen Heimat 1582 Isabeau van Achelen (†8.5.1603) geheiratet
und dort mit ihr die Kinder Hans (14.12.1580–27.9.1638) und Isabeau (4.2.1583–17.2.1662)
bekommen. Die heiratete am 22. November 1601 Rudolph Amsinck
(9.11.1577–1.12.1636). Obwohl das Ehepaar vierzehn Kinder bekam, blieb dieser
Familienzweig für Horn bedeutungslos, im Gegensatz zu Bruder Hans. Der heiratete am 3.7.1606 Sara Amsinck
(1.2.1582–1.2.1647), mit der er sechs Mädchen und am 28.9.1614 auch einen Sohn
bekam, den sie Wilhelm nannten. Am 6.1.1640 heiratete der
Helene van Overbeke (15.12.1615–11.9.1679). Ihren Sohn nannten sie ebenfalls
Wilhelm, doch nachdem sein Vater am 19. August 1680 verstorben war, wollte Sohn
Wilhelm das Horner Landhaus nicht übernehmen, sondern liebäugelte mit einem weitaus
größeren Anwesen auf Billwerder, das er als wohlhabend gewordener Mann im Jahre
1684 auch erwerben konnte. Die Familie de Hertoghe war seit ihrer Ankunft in
Hamburg sehr erfolgreich im Iberienhandel.
Nachdem Hans am 27.9.1638 verstorben war, lebte
Ehefrau Sara noch bis zu ihrem Tod am 1.2.1647 im Haus, gemeinsam mit Sohn Wilhelm und dessen Ehefrau Helene (†11.9.1679).
Beide hatten vermutlich zwei Söhne, von denen der eine Peter (†1712) hieß, den
das Horner Grundbuch am 14. Mai 1709 im Zusammenhang mit Landeigentum in Horn
erwähnt. Unter demselben Datum ist auch ein Hans de Hertoghe eingetragen, doch
ist ungewiss, ob auch beide im Horner Landhaus wohnten oder es einem von ihnen
gehörte. Sicher ist nur, dass Philip Christoph de Hertoghe seit 1727 neuer Grundeigentümer war, der sein Geld als Bankier in
Hamburg verdiente.
Dem in Hamburg geborenen Schaproder Prediger Lorenz
Maneke (27.6.1681‒25.8.1757)
verdanken wir eine Beschreibung des Grundstücks. Er reiste am 23. September
1745 in einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche mit Knecht, Ehefrau Sophia
Agnes sowie den Töchtern Catharina Dorothea (*1722), Ulrica Maria (*1725) und
Sophia Georgia (*1730) zu seinen Zwillingsbrüdern Jochim und Jürgen, die
derzeit aber in Jürgens Landhaus auf Billwerder wohnten, sonst aber als
Zuckerbäcker arbeiteten. Nach einigen Zwischenstationen erreichten sie am 1.
Oktober (Freitag) Billwerder, wo sie freudig empfangen wurden und in Hamburg
erlebnisreiche Tage verbrachten. Am 10. Oktober (Sonntag) fuhr die Familie mit
Jürgens Ehefrau Martha (1700‒1755) samt Tochter Agnetha Catharina (11)
und Sohn Hermann (12) in zwei Kutschen nach Hamm, wo man in der Dorfschaft Horn
den prächtigen Garten des Herrn Philip Christoph de Hertoghe erreichte, der sie
zu einem Rundgang auf seinem Anwesen einlud. Maneke schrieb später in sein
Tagebuch:
„Traten daselbst ab in
Garten des reichen Kaufmanns Herrn de Hertoghe, der an Schönheit, Pracht und
Magnificenze alle Hamburgischen Gärten, auch sogar den kostbaren Garten des
Herrn Jobst von Overbeck ganz übertrifft. Gewiß, wo ich jemals was Rares in der
Welt zu sehen bekommen habe, so auf diesem Garten. Ein sehr prächtig Palais mit
einer Zugbrücke, stand in demselben mitten in einem sehr großen Karpfen-Teiche
auf hohen steinernen Pfeilern. Hiernächst fand sich daselbst eine ganz neu
erbauete Grotte, deren Wände nicht allein mit köstlichen Perlen, Muscheln und
Mineralien vortrefflich ausgezieret waren, sondern auch mit vielen springenden
Fontainen prangeten, so, bei der großen Sonnenhitze, uns die ausnehmendste
Erfrischung gaben. Das sich auf diesem Garten befindliche Orangerie-Haus sah
mehr einer Kirche als einem Hause ähnlich und war mit Zitronen und Apfel de
chine-Bäumen, nebst anderen raren Gewächsen aus Afrika und Amerika ganz
angefüllet und ward um derentwillen täglich mit sechs Oefen gehitzet, damit die
Früchte möchten reif werden. So waren auch sonsten noch in des Herrn de Hartogs
Garten sehr viele herrliche Fontainen und Springbrunnen, welche der Inspector
bei unserer Anwesenheit alle miteinander springen ließ, so daß wir nicht
wußten, wo wir sollten zuerst unsere Augen hinschlagen. Und nächst bei diesem
unvergleichlichen Garten war ein großer weitläufiger Thiergarten, worin Rehe,
Hirsche und Hasen in großer Menge liefen, imgleichen ein prächtiges hohes
Vogelhaus von dicken eisernen Stangen, worin viele asiatische, afrikanische und
amerikanische Vögel zu sehen waren und welche des Winters in warmen Zimmern
aufbehalten werden. Bei dem Eingange der Garten-Thüre lag ein angekleideter
Affe an der Kette, der viele kurzweilige Possen machte. Der Inspector
berichtete uns, daß dem Herrn de Hertoghe, dieses alles in gutem Stande zu
erhalten, jährlich über 2.000 Reichsthaler koste. Weil er aber mehr als eine
Million reich, und dabei keine Kinder, so estimire er solches nicht.”
Nachdem Philip Christoph de Hertoghe 1755 verstorben war, wohnte die Witwe
noch bis zu ihrem Tod im Haus. Sie war die Schwester des Hamburger Kaufmanns Johann Friedrich Droop, dem seit 1737 ein großes Sommerhaus an der
Landstraße gehörte (heute Höhe Nr. 206). Letztmalig erwähnt wurde sie am 29. Mai 1760, als "Bauernvogt Bostelmann und Konsorten
beim Landherren waren, um die Erlaubnis zum Vogelschießen einzuholen, das wegen
Schadhaftigkeit der Stange seit 1751 nicht mehr stattfinden konnte."
In dem Bericht hieß es weiter: "Vogel
und Schilde verwahrte das Jahr über die Witwe de Hertoghe in ihrem Haus, wofür
sie den Gewinn und drei Reichstaler erhielt." Als sie 1763 starb endeten
auch 133 Jahre Horner Familiengeschichte. Keine andere Hamburger
Kaufmannsfamilie zuvor oder danach war hier über so lange Zeit ansässig!
Neuer
Grundeigentümer wurde "Etatsrath" (Staatsrat) Carl Friedrich Richardi
(†1803), dessen Stadtwohnung an der Großen Drehbahn 392 lag. Im Garten seines
Sommerhauses ließ er 1781 Denkmäler für Denner, Hagedorn, Telemann und 1787 für
Sonnin aufstellen. Weitere Grundeigentümer waren: Johann Heinrich Berckemeyer
(1794 bis September 1825), Landmann Johann Hinrich Stelter (1825–†1848) und
Georg Wilhelm Carstens (1848–1861), der an die Burgfelderstraße 24 zog. Laut
Adressbuch (künftig "AB" geschrieben) war er "Hausmakler und privilegirter Herausgeber der hiesigen Geld- und
Wechsel-Course" und hatte zuvor an der Hammer Landstraße 117 gewohnt.
Von 1859–1861 steht er auch als Vogt in den AB. Nachfolgender Grundeigentümer
war der Hausmakler Johannes Bade, doch im Straßenverzeichnis der AB fehlt bis
1869 die Hausnummer. Was war wohl geschehen? Bade könnte von seinem Geschäft am
Alsterdamm 9 aus spekuliert, aber keinen Käufer für das alte Haus gefunden
haben. Seit 1870 jedenfalls steht er als Bewohner im AB. Nach seinem Tod im
Jahre 1878 verkauften die Erben das Grundstück 1880 an den Schlachtermeister
Weichard Jacob Eberhard, doch bewohnt wurde das Landhaus seit 1879 vom Kaufmann
N.R. Fienemann und seit 1881 von J.H.C. Benthaak. Im Jahre 1882 bezog Eberhard
sein Haus selbst, doch verkaufte er es 1889 und zog an die Buchtstraße 4. Neuer
Grundeigentümer wurde Gustav Beit aus der Chemiefabrik "Beit &
Philippi" vom Neuen Jungfernstieg 15, doch wollte er hier nicht wohnen,
sondern das Haus vermieten. Mit dem Firmeninhaber Hermann Brauss fand er 1890
einen Interessenten, der sich sogar einen Gärtner leisten konnte: Von 1892–1897
war das Carl Reimann und von 1897–1899 Carl Schiller. Im Jahre 1899 zog Martin
Wiede ins Haus, der die Immobilie im Jahr darauf auch erwarb, gemeinsam mit
seinem Bruder Wilhelm. Während Martin mit seiner Familie im Haus wohnen blieb,
hatte sich Wilhelm gleich westlich daneben eine neue Villa errichten lassen
(siehe Nr. 125). Das alte Landhaus, mit Wohnräumen für die jeweiligen Kutscher
im hinteren Teil, wurde 1910 abgebrochen, um die Hertogestraße anzulegen.
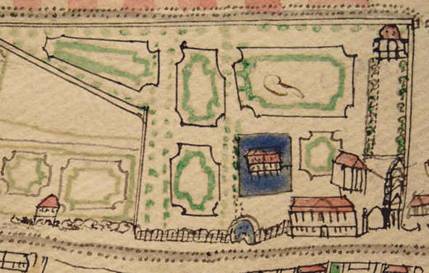

Horns erste Flurkarte von 1751 zeigt das
im Teich stehende Palais und ein im klassizistischen Stil erbautes
stattliches Landhaus, ähnlich dem der
Familie Duncker an der Horner Landstraße 246 (rechts).
Auf der Dorfkarte von 1826 ist das
Palais nicht mehr zu sehen, dafür aber ein doppelt so großer Teich.
Auf der
Flurkarte von 1751 steht gleich westlich des Hertoghischen Anwesens ein
einstöckiges Haus direkt an der Landstraße. Wem es derzeit gehörte ist nicht
bekannt, doch 1771 soll es der Kaufmann Albert Heinrich Adamy (1739-0713–12.3.1799) erworben haben,
dessen Hamburger Geschäftsräume an der Gröningerstraße C1 Nr. 63 lagen. Am 28.
Januar 1766 hatte er Margaretha, geborene Krohn (10.10.1742–15-1.1809)
geheiratet, doch Kinder bekamen sie nicht. Am 15. Februar 1788 wurde er
Ratsherr.
Im Jahre 1816
erwarb der Kaufmann Heinrich Johann Merck (27.2.1770–23.10.1853) das Grundstück
samt Baulichkeiten. Aus seiner Geburtsstadt Schweinfurt hatte es ihn 1793 nach
Hamburg gezogen, wo er mit industriell gefertigten englischen Baumwollgarnen
handelte. Während der Kontinentalsperre durch Napoleon erwarb er durch
Schmuggel ein bedeutendes Vermögen und war 1813 schon so reich, dass er
zusammen mit anderen einen großen Teil der von den Franzosen geforderten hohen
Kontributionen zahlen konnte. Speicher und Kontor seiner Firma befanden sich in
einem Teil des sogenannten Mortzenhauses in der Straße "Alter
Wandrahm", das er 1810 erworben hatte. Aus seiner Heirat mit Maria
Catharina Danckert (13.2.1771–8.7.1809) am 9.11.1802 gingen vier Kinder hervor:
Heinrich Johann (15.7.1804–18.3.1835), Maria Carolina Friederica
(3.7.1806–9.12.1884), Marie Pauline (20.3.1808–23.3.1861) und Carl Hermann
(3.5.1809–16.10.1880), später Syndikus zu Hamburg. Nachdem seine Frau kurz nach
der Geburt von Carl Hermann gestorben war, heiratete Merck am 14. Oktober 1810
Marianne Rohlffs (12.10.1780–14.4.1853). Mit ihr bekam er die Kinder: Ernst
(20.11.1811–6.7.1863), später Kaufmann und Finanzminister des Deutschen
Parlaments von 1848 sowie 1863 Mitgründer des Zoologischen Gartens in Hamburg),
Molly (10.12.1812–26.10.1897) und Theodor (3.10.1816–21.11.1889), der am 8.
Juli 1851 die Hamburger Kaufmannstochter Emilie Amsinck heiratete und
Mitinhaber der väterlichen Firma war.
Schon vor der Geburt Theodors war das Sommerhaus der Mercks an
der Hammerlandstraße 45 (Hausnummer bis 1868) zu klein geworden, und so erwarb
man das einst Albert Hinrich Adamy und seiner Frau Margaretha gehörende
Landhaus im Nachbardorf Horn. Aus jener Zeit steht noch heute eine Stiel-Eiche
mit einem Stammumfang von fast viereinhalb Metern. Die Dorfkarte von 1826 zeigt
zwar immer noch die alten Gebäudeumrisse, doch eine Lithografie von 1836
dokumentiert bereits eine gerade bezogene klassizistische Villa. Architekt war der
angesehene Franz Gustav
Forsmann (1795–1878).
Merck, der
am 3. März 1820 Hamburger Senator wurde, pflegte im geräumigen Gartenhaus auch
eine bedeutende Kakteensammlung, deren gedruckter Katalog sogar im Ausland
bekannt war. Auch züchtete der Pflanzenliebhaber Orchideen und Dahlien, eine
von denen sogar benannt als Merck-Dahlie (Dahlia
merkii). Ein halbes Jahr nach dem
Tod seiner Ehefrau starb auch der nunmehr 83-jährige Merck. Sein Sohn Dr. Carl
Hermann verwaltete das Erbe, denn noch fünf weitere Kinder hatten ja Ansprüche.
Es lag also im Interesse aller, die Immobilie so schnell wie möglich zu
verkaufen. Mit dem Grafen zu Solms fand er 1854 einen Interessenten. Eine
schöne Lithografie aus dem Sommer 1854 blieb der Nachwelt erhalten, angefertigt
von Christian Ludwig Wilhelm Heuer (6.11.1813–15.4.1890), dem seinerzeit
angesehensten Maler und Zeichner Norddeutschlands. Leider beschrieb er das Foto
"Landhaus Graf Solm", was Heimatforschende später verwirrte. Erst im
Dezember 2022 klärte sich, dass er "zu Solms" hieß.
Die Familiengruft der Mercks befindet sich noch heute im
Jakobipark, der 1848 als Friedhof der Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg-Eilbeck
angelegt worden war. Am 8. Oktober 1858 verkaufte Graf zu Solms sein 28.877 qm
großes Anwesen an den Kaufmann Hermann Friedrich Julius Leser (1815-1030–1874-0806), der hier mit
Ehefrau Julie Mathilde, geborene Heimendahl (1823-0408–10.9.1900) und
Sohn Richard Gustav Leser (1847–1919) wohnte.
Im Spätsommer 1872 ließ er am nördlichen Arealrand ein Stallgebäude nebst Kutscherwohnung
errichten und den Eiskeller überdachen. Auch das freistehende strohgedeckte
Eishaus konnte bis Ende Oktober erneuert werden und bestand nun aus Fachwerk
und einem Schieferdach. Nachdem Julius Leser in Frankfurt/Main verstorben war,
ließ die Witwe ihr Eigentum am 18. Juni 1875 versteigern und zog an die
Sierichstraße 4, einer neuen Villa, die sie durch den Verkauf des Horner
Landhauses mitfinanzierte. Sie starb in ihrem letzten Domizil An der Alster 23.
Am 18. Juni 1875 ersteigerte Ludwig Friedrich Blohm (13.1.1837–26.3.1911)
das Grundstück im Assecuranzzimmer der Hamburger Börsenhalle. Sein Vater Georg (9.11.1801–6.3.1878) war
anno 1825 nach St. Thomas in die Karibik ausgewandert und vier Jahre darauf
nach Venezuela in die Stadt La Guaira gezogen, um dort ein Handelsgeschäft zu
gründen. Als sich bald der große Erfolg einstellte, gelang die Familie zu
Ansehen und Einfluss. Am 28. Mai 1834 heiratete Georg Blohm die Tochter des
örtlichen dänischen Friedensrichters Anna Margaretha Lind (14.12.1807–10.10.1878).
Der erworbene Wohlstand ermöglichte es Blohm, bereits im Alter von 42 Jahren in
seine Heimatstadt Lübeck zurückzukehren, um so einen ordnungsgemäßen
Schulbesuch für seine Söhne Georg Heinrich (14.7.1835–16.1.1909) und Ludwig Friedrich sicherzustellen.
Beide führten später die
begonnenen Handelsaktivitäten in Venezuela und Hamburg fort. Ihre Schifffahrtsgesellschaft
"G.H. & L.F. Blohm" beförderte Post zwischen La Guaira, Puerto
Cabello, St. Thomas und Curaçao. Um 1863 gab diese sogar eigene Briefmarken
heraus! Wilhelm Eduard (1.4.1840–10.2.1915), der erst in Lübeck geborene dritte
Sohn, wurde 1864 Gutsherr auf Viecheln in Mecklenburg und Hermann Blohm
(23.6.1848–12.3.1930) gründete am 5. April 1877 zusammen mit Ernst Voss in
Hamburg das spätere Weltunternehmen "Blohm & Voss".
Seit dem 14. August 1876 besaß das Weinhaus eine
Warmwasserheizung, und am 25. Februar 1878 wurde auch noch ein Fruchthaus
fertiggestellt. Nachdem die Villa im Jahre 1889 vergrößert worden war,
erstrahlte auch ihr Äußeres in neuem Glanz. Über der Veranda gab es einen
großen Balkon, und das jetzt höhere Dach hatte man mit schmiedeeisernem Zierrat
versehen. 1896 wurden Remise und Pferdestall derart erweitert und umgebaut,
dass auch Obergärtner Rudolf Bünger sowie Kutscher und Stallbursche hier wohnen
konnten. Ein Jahr darauf entstand ein noch größeres Gewächshaus. In seiner
Ausgabe vom 8. Dezember 1900 lobte das "Hamburger Fremdenblatt" den
Park mit seinen wertvollen Pflanzen und gefüllten Gewächshäusern: „Dieser Garten braucht den Vergleich mit den berühmtesten
Gartenbesitzungen in Harvestehude nicht zu scheuen.“ Schon ein paar Monate später erhielt
das Anwesen elektrische Beleuchtung. Als am 29. August 1903 das Gerüst des
Gewächshauses einstürzte, wurden drei Arbeiter unter den Trümmern begraben.
Zwei verletzten sich dabei schwer, einer leicht.
Im Jahre 1885 hatte Blohm übrigens eine prächtige silberne
Spenden-Büchse für die anno 1585
in Hamburg gegründete "Niederländische Armen-Casse" gestiftet. Anfangs nur für bedürftige
Niederländer gedacht, entwickelte sie sich bald zur stillen Wohltäterin auch
für Hamburger Bürger. Bei den alljährlichen Feiern der Casse wurde die Büchse
stets während des Essens herumgereicht.
Nachdem Blohm gestorben war, lebte die Witwe noch bis zu ihrem
Tod am 28. Oktober 1916 in der Villa. Räume hat sie wohl nicht vermietet, denn
die Adressbücher vermerkten keine sonstigen Bewohner. Erst unter den neuen
Eigentümern Peter Siemsen und Professor Eduard Arning zogen am 15. Oktober 1919
Albert Carl Eduard Fleck (1861‒1920) und seine Ehefrau Emma
Caroline (1862‒1824) ins Dachgeschoss. Ihre Kinder waren Elsa Maria
(1888), Helene Martha Margarethe (1892), Olga Elisabeth (1895) Kurt Johann
(1900) und Heinrich Hans (1904). Zwei bereits verstorbene Kinder hießen Emma
Katharina (1890–1907) und Albert Wilhelm (1893 geboren, aber am 3. Juni 1918 im
Krieg gefallen). Weitere Mietparteien: In der Kellerwohnung der Bürobeamte
August Ey (†1921), danach die Witwe, im Erdgeschoss der Prokurist Martin
Schubarth und im Obergeschoss der Prokurist H. Peters sowie Kaufmann Rudolf
Wassmann.
Im Frühjahr 1921 wurden Wintergarten und das Gewächshaus nebst
Kuppelhalle abgebrochen.
Der Park könnte heute auch
"Hinrichsen Park" heißen, denn letzter Grundbesitzer war Claus
Heinrich Hinrichsen, der das Grundstück im Januar 1922 von Blohm’s Erben erwarb
und hier einzog. In den wenigen Jahren als Eigentümer konnte Hinrichsen das
Gelände jedoch nicht neu prägen. Seine Absicht, es mit kleinen Villen im Stil
der westlich des Parks gelegenen Feck’schen Häuser bebauen zu lassen, stieß auf
den Widerstand der Genehmigungsbehörden, die immer wieder neue Auflagen
machten. Am 21. August 1928 überließ Hinrichsen die Immobilie der
Finanzdeputation Hamburg und bekam dafür das von den Straßen Beim Pachthof,
Pagenfelder Straße, Bei der Martinskirche und Scheteligsweg begrenzte
Grundstück. Er selbst wohnte noch einige Jahre als Pächter in der alten Villa.
Zunehmend verwilderte der Park, und erst 1934 machte die Stadt
aus dem Areal für 67.000 Mark eine öffentliche Grünanlage, begrenzt im Norden von der Straße Beim Rauhen Hause, im Osten
von der Hertogestraße, im Süden von der Horner Landstraße und im Westen von
einem Fußweg, der ab 15. Juli 1929 "Kernbek" heißt, einst auch als
"Brauertwiete" oder "Weg Nr. 389" bezeichnet worden war. An
der Nordostecke der Westwiese, im Bauwinkel von Pferdestall und Remise
(Kutschenraum), luden jetzt idyllische Sitzreihen zum Verweilen ein. Den
ehemaligen Parkteich hatte man zugeschüttet und in der Senke eine Freilichtbühne
angelegt, die bald so begehrt war, dass sie erweitert werden musste.
Alljährliche Volksbelustigungen, Kinderfeste sowie Schul- und
Vereinsvorführungen blieben den Zeitzeugen noch lange in schöner Erinnerung.
Hier formierten sich auch die beliebten Musik- und Laternenumzüge, um sich
später am selben Ort wieder aufzulösen.
Bis zu ihrer Zerstörung im Jahre 1943 war in der "Villa
Blohm" die Kreisleitung des Kreises V. der NSDAP untergebracht. Dazu
gehörte die Deutsche Arbeits-Front (D.A.F.) und die N.S.-Rechtsbetreuungsstelle.
Bis Kriegsende wurde noch in einer Baracke weitergearbeitet.
"Blohm’s Park" hatte sehr unter
dem Krieg gelitten, wurde aber leider nicht so großzügig erneuert wie der
Hammer Park. Nachdem die Reste der zerstörten Villa im Frühjahr 1950 gesprengt
und beseitigt worden waren, begannen gleichenorts Ende November die Bauarbeiten
für das Jugend-Europa-Haus. Die Idee hierzu hatte der dänische Theologe und Dramatiker Karl
Nielsen (16.4.1895‒8.3.1979), der hier die Zusammenarbeit zwischen den Völkern
fördern wollte. Unter dem Vorsitz von Professor Sieverts vom Seminar für
Jugendstrafrecht war der "Verein Jugend-Europa-Haus" gegründet worden
und zwar auf Anregung der Dänischen Gesellschaft für zwischenvölkische
Zusammenarbeit "Mellemfolkeligt Samvirke". Sie organisierte den
Transport des in seine Einzelteile zerlegten norwegischen Holzhauses, das im
Dezember 1950 mit dem Küstenmotorschiff "Gerda Luise" nach Hamburg gebracht wurde. Den Transport vom Hafen
zum Blohm's Park organisierten freiwillige Helfer, die unter der Leitung eines
dänischen Zimmermanns auch die Aufbauarbeit leisteten. Bereits im Herbst 1950
waren dort Teile der ehemaligen Kellerräume der alten Villa für den Keller des
neuen Hauses freigelegt worden, der im November neue Mauern erhielt. Das Haus
konnte deswegen relativ zügig aufgestellt werden, zusammen mit dem Anbau, in
dem sich der große Saal befand, der sich direkt über dem tiefen Ziehbrunnen der
ehemaligen Villa befand. Kurz vor Weihnachten feierte man Richtfest. Im Januar
1951 waren auch die Innenausbauten weitgehend abgeschlossen. Am 1. März 1951 fand die Eröffnungsfeier statt, konnte
das "Jugend-Europahaus" seiner Bestimmung übergeben werden. Das
Gebäude bestand aus Erdgeschoss und Obergeschoss mit Dachschrägen. Im
Erdgeschoss gab es mehrere Zimmer, eine Küche und einen Wirtschaftsraum. Einer
dieser Räume wurde als Büro und Arbeitszimmer des Leiters, die beiden anderen
zur Betreuung von Kindergruppen bzw. als Lese- und Gesprächsräume für die
Jugendlichen genutzt. Im Dachgeschoss befand sich die Wohnung des Leiters,
bestehend aus einem Wohn- und kleinem Schlafraum sowie einem Lesezimmer. In den
Kellerräumen gab es Waschraum, Toiletten und Dusche. Außerdem befanden sich
dort Räume, die später von wechselnden Interessengruppen genutzt wurden.
Zeitgleich mit dem Aufbau des Hauses wurde an der Ostseite ein ebenerdiger Saal
angebaut, der auch als Tagungsraum für 30 bis 40 Personen diente. Hier war auch
der Haupteingang zum Haus. Als 1958 ein dringend notwendiger weiterer Anbau an
der offenen Seite des Saals erstellt wurde, verlegte man den Eingang zum Haus
hierher. Über einen kleinen Flur gelangte man zuerst zu einem Spielzimmer, dann
zu dem in dieses Gebäudeteil verlegten Büro. Auch die
Küche wurde hier neu eingerichtet und ein Zugang zum Saal geschaffen. Das
Obergeschoss des Anbaus bot Gästezimmer, wenn auch die Sanitäranlagen weiterhin
nur im Keller waren. Hier gab es auch zwei weitere Gruppenräume, einer davon
wurde seit den frühen 1960er Jahren als Fotostudio genutzt.
Die Menschen des Stadtteils schätzten das im Stil eines
Norwegerhauses erbaute "JEH", denn für Kinder und Jugendliche war es
Treffpunkt in einer noch immer düsteren Trümmerlandschaft. Im Jahre 1959
erweiterte man das Haus und beschäftigte fortan zwei Mitarbeiter. Nachmittags
war Frau Steen für die Kinder zuständig, abends Herr Brahms für die
Jugendlichen (seit April 1964 Herr Schuster). An Tanzabenden spielten Rock- und
Beatbands und über alle Ereignisse informierte die von Heinz Dofflein
herausgegebene Heimzeitung "Punkt". Als Interessengruppenleiter
gründete Gerd Rasquin (22) im Jahre 1966 den ersten Kinderzirkus Deutschlands:
"Circus Blomi", der aber nur in Hamburg auftrat. Von Oktober 1970 bis
Februar 2020 war der spätere Schullehrer auch mit Leistungsgruppen im Horner TV
tätig.
Die letzte größere Veranstaltung auf der schon recht
heruntergekommenen Freilichtbühne fand am 13. September 1959 statt, als die
Erwachsenen des Hamburg-Horner Turnvereins ab 19:30 Uhr ein Schauturnen
veranstalteten. Im Frühling 1961 wurde das Bühnenareal zu einem
Kinderspielplatz umgestaltet, der "Eiserne Löwe" vom Gärtnerhaus dorthin
transportiert. An der Nordostecke des Parks entstand 1970 zusätzlich ein
Waldspielplatz, und mit Schachecke und Skatplätzen war auch an die Erwachsenen
gedacht worden!
Das Jugend-Europa-Haus wurde 1967 Dänisch-Deutsche Akademie. Nach 16-jähriger erfolgreicher Arbeit
übergab Pastor Karl Nielsen (72) im Mai die Leitung des Hauses an seinen
Landsmann Børge Møllgaard
Madsen (29.5.1920‒1975). Von Januar 1970 bis 1999 war dann Carl Nyholm
Direktor, der noch im Jahre 2021 als 92-Jähriger lebte.
Der neben dem Tagungsraum liegende östliche Bereich wurde 1982
abgebrochen und durch einen großen Neubau ersetzt, den man am 4. November 1983
festlich einweihen konnte. Bei den Umbauarbeiten war man übrigens nicht nur auf
Backsteinmauern der einstigen Villa gestoßen, sondern auch auf ihren ehemaligen
Brunnen. Der war so tief, dass man nicht bis auf den Boden hinunterblicken
konnte. Er befand sich einst innerhalb der Villa, denn erst ab 1874 gab es in
Horn eine städtische Wasserversorgung. Der Brunnen wurde seinerzeit aber nicht
zugeschüttet, sondern mit einer Betondecke versehen, über welcher heute der
Tagungsraum liegt. Nachdem Dänemark die Akademie im Frühjahr 1999 aus
finanziellen Gründen aufgeben musste, wurde Hamburg am 1. Juni Eigentümer des
Objekts, das sich fortan Europa
Gästehaus nannte.
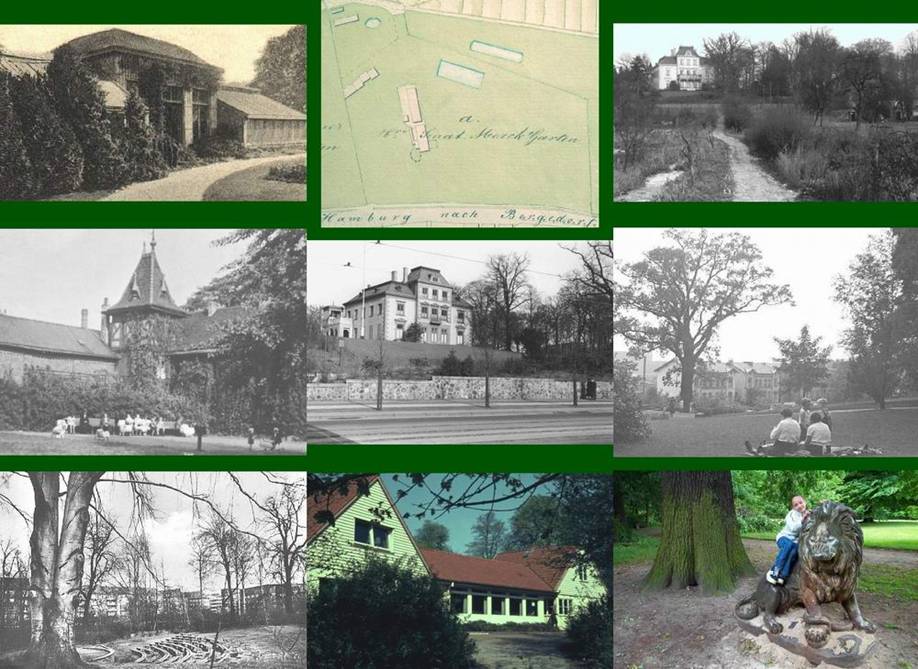
Ehemaliges Gartenhaus - Landkarte von
1826 - Villa Blohm von der Marsch aus gesehen - Remise - Villa 1937 - Hangwiese
Freilichtbühne in den 1950er Jahren -
Jugend-Europa-Haus 1967 (einst Standort der Villa) - Löwe und Eiche im Sommer
2001
Über das Areal und die Räume der Villa gibt folgende
Versteigerungsanzeige vom 8 Juni 1875 Auskunft:
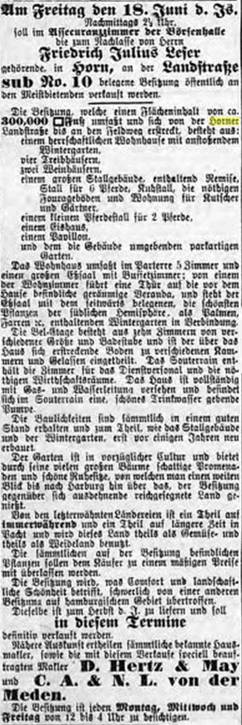
An vergangene Zeiten erinnert heute nur noch weniges: Der Name Blohm, die Hertogestraße und die den
einstigen Parkteich umsäumenden Bäume aus der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Neben der wunderschönen Doppel-Blutbuche auch Horns ältester
Baum, eine Eiche mit über viereinhalb Metern Stammumfang, die wohl Grundeigentümer
Merck 1817 als bereits vorgezüchtetes Bäumchen setzen ließ. Sie steht direkt
neben einer Löwen-Plastik, die seit Herbst 1874 bis Juli 1943 zur Freitreppe
des Ohlendorff’schen Palais an der Burgstraße in Hamburg-Hamm gehörte. Doch das
ist eine andere Geschichte, nämlich die vom